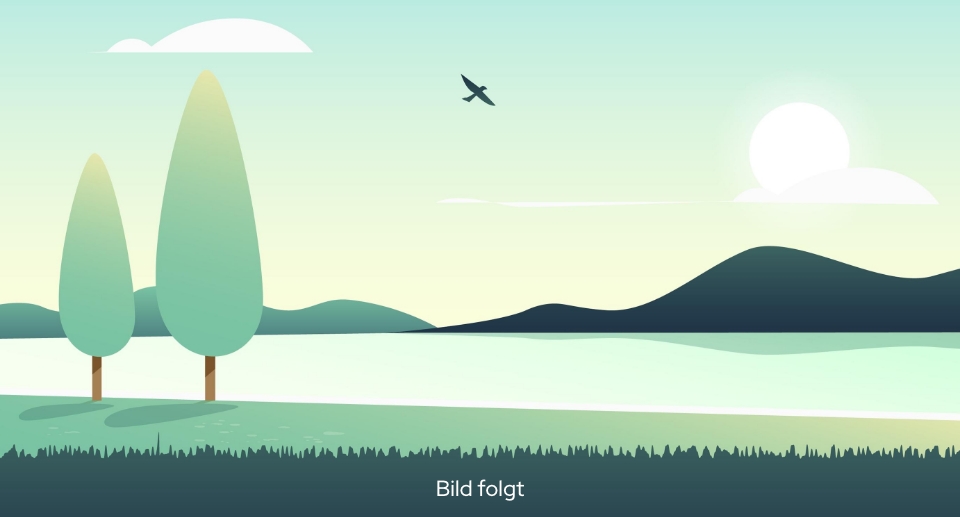Treue fürs Leben oder stets wechselnde Partner? Das Liebesleben der Vögel ist so bunt wie ihr Gefieder. In diesem Artikel erfahrt ihr, warum manche Arten monogam leben und andere nicht.
Das Paarungsverhalten von Vögeln
Die Welt der Vögel ist erstaunlich vielfältig. Und das gilt nicht nur für ihre Farben, Gesänge oder Flugkünste, sondern auch für ihr Sozial- und Fortpflanzungsverhalten. Während einige Vogelarten lebenslange Paare bilden, wechseln andere regelmäßig ihre Partner oder leben in komplexen Gruppenstrukturen. Diese Bandbreite an Fortpflanzungsstrategien ist das Ergebnis jahrtausendelanger Anpassung an Umweltbedingungen und evolutionäre Herausforderungen.
Was bedeutet „monogam“ im Tierreich?
Im Unterschied zum menschlichen Verständnis bezieht sich Monogamie bei Tieren in erster Linie auf Fortpflanzung und Brutpflege. Eine „soziale Monogamie“ liegt vor, wenn ein Vogelpaar über eine Brutperiode (oder sogar lebenslang) zusammenbleibt, gemeinsam ein Nest baut, Eier ausbrütet und die Jungen großzieht.
Dabei bedeutet Monogamie nicht zwangsläufig sexuelle Exklusivität: Man ist sich mittlerweile recht sicher, dass selbst in monogamen Vogel-Partnerschaften sogenannte „Seitensprünge“ häufig vorkommen. Auf diese Weise versuchen die Männchen, ihre Gene möglichst weit in die nächste Generation weiterzugeben.
Ursachen für Monogamie und Polygamie bei Vögeln
Aber warum leben manche Vogelarten in festen Paarbeziehungen, während andere regelmäßig ihre Partner wechseln? Die Antwort hängt je nach Vogelart von vielen verschiedenen ökologischen Faktoren wie Brutpflege, Nahrung oder Lebensraum ab.
In vielen Fällen bestimmen die individuellen Umweltbedingungen darüber, ob Vögel monogam oder polygam leben. Bei manchen Vogelarten ist es sehr aufwendig, die Jungen großzuziehen. Das ist zum Beispiel so, wenn es wenig Futter gibt oder die Jungen lange Schutz brauchen. In solchen Fällen ist es hilfreich, wenn sich beide Eltern um die Aufzucht kümmern. Hier ist soziale Monogamie dementsprechend besonders häufig. Höckerschwan, Blaumeise und Schleiereule sind bekannte Beispiele für Arten, die in sozialer Monogamie leben.
Anders sieht es wiederum in Lebensräumen aus, in denen Nahrung im Überfluss vorhanden ist oder der Nachwuchs früh selbstständig wird. Hier kann es sich für das Männchen lohnen, mehrere Partnerinnen zu suchen, um die Zahl seiner Nachkommen zu maximieren. Dabei ist er selbst nicht an der Aufzucht der Jungen beteiligt. Ein typisches Beispiel ist der Pfau: Das Männchen imponiert mit seinem auffälligen Gefieder und balzt mehrere Weibchen an. Nach der Paarung übernimmt das Weibchen allein den Nestbau und die Aufzucht. Auch bei vielen Fasanenarten oder Vögeln der Paradiesvogel-Familie ist dieses Verhalten verbreitet.
Titelfoto: iStock.com/Grafner