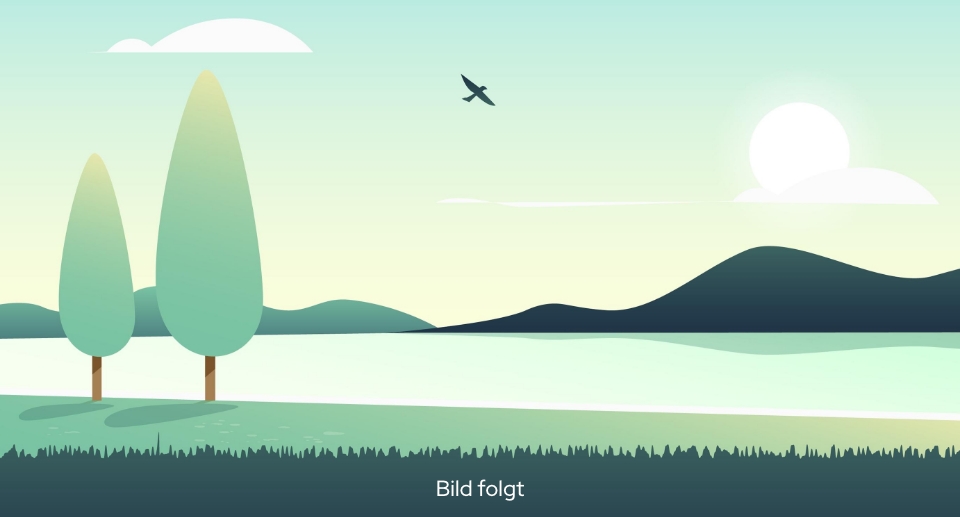Jedes Jahr brechen Millionen von Vögeln zu einer Reise auf, die oft tausende Kilometer lang ist. Und das ganz ohne Navigationsgerät, Karten oder Kompass. Ob Kranich, Graugans oder Mönchsgrasmücke: Sie wissen alle genau, wann es Zeit ist zu starten und wohin sie fliegen müssen. Doch wie genau funktioniert die Navigation von Zugvögeln eigentlich? In diesem Artikel erfährst du, welche inneren Mechanismen Zugvögel in Bewegung setzen und wie sie sich auf ihrer Route orientieren.
Was setzt Zugvögel zur richtigen Zeit in Bewegung?
Auch wenn Zugvögel keinem Kalender folgen, wissen sie stets genau, wann es an der Zeit ist, zu ihren Winterquartieren oder zurück nach Hause aufzubrechen. Es ist fast so, als hätten sie eine innere Uhr, die ihnen verrät, wann der richtige Zeitpunkt für ihre Reise gekommen ist.
Der wichtigste Auslöser für diese erstaunliche Fähigkeit ist die Veränderung in der Tageslänge. Wenn im Spätsommer die Nächte länger werden, machen sich durch die geringere Helligkeit hormonelle Veränderungen bei den Vögeln bemerkbar. Durch diese fressen die Vögel mehr, legen dadurch Fettreserven an und entwickeln eine innere Unruhe. Dieses sogenannte Zugverhalten ist angeboren und wird von einer Generation an die nächste weitergegeben. Man kann also tatsächlich sagen, dass Zugvögel über eine innere Uhr verfügen. Zusätzlich spielen auch Faktoren wie der Luftdruck, das Nahrungsangebot und die Temperatur eine Rolle, wobei das Licht der verlässlichste Taktgeber ist.
Wie Zugvögel ihren Weg finden
Hat der innere Kalender erst einmal den Startschuss gegeben, stellt sich direkt die nächste Frage: Woher wissen Zugvögel eigentlich, wohin sie fliegen müssen? Die Natur hat ihnen dafür ein ganzes Repertoire an Orientierungshilfen mitgegeben. Besonders faszinierend ist dabei der Magnetsinn, mit dessen Hilfe Zugvögel das Erdmagnetfeld wahrnehmen können. So nutzen Vögel wie Rotkehlchen oder Drosseln dieses unsichtbare Feld, um ihre Flugrichtung auszurichten.
Zusätzlich dazu orientieren sich viele Arten bei ihrer Reise an der Sonne (z.B. der Star) oder am nächtlichen Sternenhimmel. Der nachtaktive Indigofink folgt beispielsweise der Richtung von Planeten, um an seinem Ziel anzukommen. Landschaftsmerkmale wie Küstenlinien, Gebirgsketten oder große Flüsse können Zugvögeln ebenfalls als visuelle Orientierungspunkte dienen. Während ältere Vögel ihrer Route meist instinktiv folgen, lernen Jungvögel oft von den älteren Tieren, die sie bei ihrem ersten Zug begleiten.
Herausforderungen bei der Routenfindung
So beeindruckend das Zugverhalten der Vögel auch ist: Bestimmte Faktoren sorgen für Herausforderungen bei der Routenfindung. Unter anderem schlechte Wetterbedingungen wie Nebel oder Regen können für eine erschwerte Orientierung der Zugvögel sorgen. Dadurch ist es schließlich schwerer, Landschaftsmerkmale zu erkennen und auch die Sonne scheint weniger intensiv. Lichtverschmutzung sorgt ebenfalls dafür, dass Sternbilder und Planeten am nächtlichen Himmel für Vögel schwerer erkennbar sind.
Auch der Klimawandel bringt die vertrauten Abläufe vieler Arten zunehmend durcheinander: Wenn der Frühling früher beginnt, verschieben sich auch das Nahrungsangebot und die Brutzeiten. So kann es sein, dass Arten zu früh oder zu spät aus ihrem Winterquartier zurückkehren und so die optimalen Bedingungen für die Brut verpassen.
Ein weiterer erschwerender Faktor für Zugvögel auf ihrer Reise ist der Schwund von Rastplätzen, beispielsweise durch die Trockenlegung von Feuchtgebieten oder anderen menschlichen Eingriffen in die Natur. Verschiedene Schutzmaßnahmen sollen dabei helfen, diese Orte zu bewahren und das Naturwunder Vogelzug auch in Zukunft zu sichern.
Titelfoto: iStockphoto.com/eurotravel